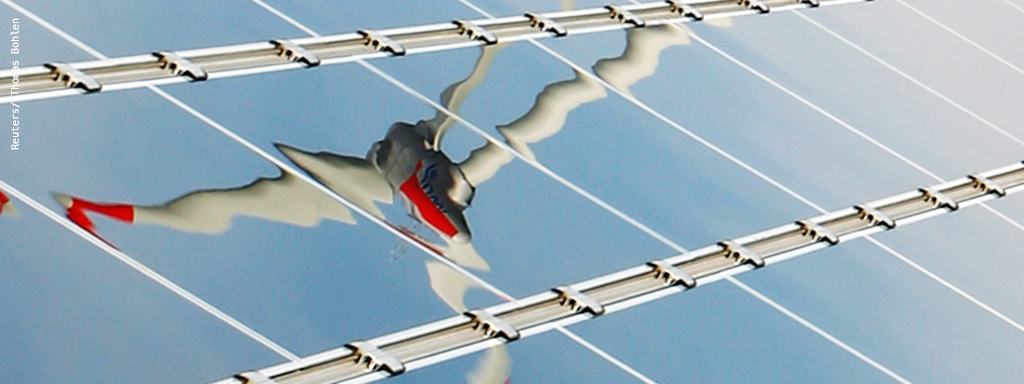Der Strukturwandel der Wirtschaft muss sein, um Ressourcen zu schonen und das Klima zu schützen. Darin waren sich die Wissenschaftler im Forum „Nachhaltige Industriepolitik“ auf dem Kurswechselkongress der IG Metall in Berlin einig. Und wenn er richtig angegangen wird, bietet er auch Chancen: zum Beispiel langfristig sichere Arbeit und neue Arbeitsplätze. Wenn das nicht geschieht, wird er als Bedrohung empfunden und erzeugt Widerstand. Ökologische Nachhaltigkeit funktioniert nicht ohne soziale Nachhaltigkeit. Und nicht ohne die Beteiligung der Menschen. Die Beschäftigten und die Gewerkschaften, so die Wissenschaftler, können viel dazu beitragen, dass der Umbau vorangeht - und ein Erfolg wird.
„Heute umzusteuern kostet uns weniger als wenn wir weiter auf morgen warten.“ Der Wechsel zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft muss sofort anfangen. Darin waren sich die Wissenschaftler einig, die am 6. Dezember auf dem Kurswechselkongress der IG Metall im Forum „Nachhaltiger Industrieumbau“ referierten. Einen Bremser auf dem „Pfadwechsel“ zu nachhaltiger Wirtschaft verortete Kurt Hübner, Professor an der University of British Columbia in Vancouver, Kanada, in den Finanzmärkten, die auf schnelle, hohe Renditen ausgerichtet sind. Sie müssten so umstrukturiert werden, dass sie wieder der Realwirtschaft dienen und Innovationsprozesse unterstützen.
Aus Verlierern dürfen keine Blockierer werden
Die Industrieproduktion, von neoliberalen Zeitgeistsurfern vor der Krise noch als „old economy“ von gestern abgekanzelt, „wird weltweit drastisch zunehmen“, prognostizierte Hübner. Aber das bisherige Wachstumsmodell habe keine Zukunft, weil es an ökologische Grenzen stößt. Die spannenden Frage sei: Wie leiten wir den Übergang in ein neues Wachstumsmodell ein. Bei der Transformation werde es viele Widerstände geben, auch unter den Arbeitnehmern. Denn es gebe Gewinner und Verlierer. „Der Prozess muss sozial begleitet werden, um die potenziellen Verlierer mit im Boot zu halten und damit aus Verlierern nicht Blockierer werden.“
Wer nachhaltig sein will, muss nicht arm sein
„Muss man arm werden, um energieeffizient zu sein?“ Diese Frage stellte Fritz Reusswig. Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Um sie gleich mit „Nein“ zu beantworten. Es stimmt zwar, dass die ärmsten Länder am wenigsten Natur und Rohstoffe verbrauchen und die Umwelt am wenigsten belasten. Aber am Beispiel des sehr unterschiedlichen Ressourcenverbrauchs von Städten – wie London, New York und Houston – zeigte er, dass Wohlstand und Nachhaltigkeit zusammen gehen können. Zersiedelte Städte erzeugen erheblich höhere Belastungen als verdichtete. Reusswig plädierte unter anderem für eine bessere Stadtplanung und mehr kommunale Investitionsprogramme. Er hält sogar eine Stärkung der Massenkaufkraft für sinnvoll – wenn sie die Menschen befähigt, Produkte zu kaufen, die besser statt billiger sind. Ferner brachte er Mehrwertsteuersätze in die Diskussion, die Anreize schaffen, grüne Produkte zu kaufen.
Nicht auf den Letzten warten
Mit dem ökologischen Kurswechsel dürfe nicht gewartet werden, bis selbst die größten Zauderer und Bremser in der Völkergemeinschaft bereit sind mitzumachen, sagte Kurt Hübner. Auch Alleingänge würden sich lohnen. Deutschland könne durch sein gutes Beispiel die positiven wirtschaftlichen Argumente liefern, um auch die anderen zu überzeugen. Wer technologisch voranschreite, habe auf dem globalen Markt wirtschaftliche Vorteile.
Reich der Mitte auf dem Weg nach vorn
Andere Länder sind schon auf dem Weg dorthin. Zum Beispiel China. In „Reich der Mitte“ stieg der Energieverbrauch innerhalb von nur zehn Jahren um 150 Prozent. Das Land ist weltweit der größte CO2-Emittent, berichtete Eva Sternfeld vom China-Institut an der Technischen Universität Berlin. „Wenn wir Klimaschutz wollen, müssen wir China mit ins Boot nehmen“. Die Volksrepublik verfolge schon „ambitionierte Ziele“. Es investiere hohe Summen in umweltfreundliche Autos. Es habe die Energieeffizienz zwischen 2006 und 2010 um 19,4 Prozent gesteigert. In verschiedenen Städten laufen Projekte, den Kohlendioxid-Ausstoß zu verringern. Die Emissionen von Kohlekraftwerken, die 80 Prozent des Energiebedarfs im Land decken, wurden stark reduziert.
Das Land sei weltweit führend bei der Wasserkraft, baue die Windenergie forciert aus, fördere die Solarenergie, wenn auch vor allem für den Export. In den nächsten Jahren will es den Anteil nichtfossiler Energie stark steigern - allerdings vor allem durch Atomkraftwerke; 25 Reaktoren sind im Bau.
Konsum hier, Umweltprobleme im Ausland
Kathryn Harrison, auch Professorin an der British Columbia-Universität, wies auf den Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und Treibhausgasen hin. So seien die CO2-Emissionen in den USA zwar seit 1990 anders als in Deutschland stark gestiegen, aber pro Kopf um zwölf Prozent gesunken. Die nationalen C02-Bilanzen, so Harrison, würden auch anders aussehen, wenn nicht nur die im Land produzierten, sondern auch die verbrauchten Güter betrachtet würden. In Deutschland zum Beispiel wären die Emissionen um 25 Prozent höher, wenn die importierten Waren – wie Nahrungsmittel, Kleidung, billiges Spielzeug – eingerechnet würden. Harrison vertrat die Auffassung, dass sich auch die Konsumgewohnheiten und Lebensstile ändern müssten.
Gegen-Lobby für Umweltschutz
Hübner wies darauf hin, dass die ökologische Umstrukturierung der Wirtschaft kein Selbstläufer ist. Die Politik müsse ihn steuern. Doch je stärkere Emissionen in einem Sektor verursacht werden, desto stärker ist die wirtschaftliche Lobby, die (erfolgreich) dagegen agiert, sagte Harrison. Dagegen müssen sich „Wachstumskoalitionen“ bilden, empfahl Hübner. Es müssten sich „Interessengruppen aus Produzenten und Verbrauchern herausbilden“, die Druck auf die Politik und Wirtschaft entfalten können und „die Entwicklung mitgestalten“. Die Gewerkschaften sind nach Auffassung von Kathryn Harrison in der Lage, in diesem Prozess „zum länderübergreifenden Lernen“ beizutragen.
Ökologische und soziale Nachhaltigkeit gehören zusammen
„Je länger wir mit dem ökologischen Umbau warten, desto schwieriger wird er“, mahnte Jürgen Kerner, geschäftsführendes IG Metall-Vorstandsmitglied. Ein Schlüssel zu nachhaltigem Industrieumbau bestehe darin, die Ressourceneffizienz der Firmen zu erhöhen. Daran müssten die Beschäftigten beteiligt werden.
Kerner wies darauf hin, dass ökologische Nachhaltigkeit nur in Verbindung zu sozialer Nachhaltigkeit funktioniert. Nachhaltige Industriepolitik könne Arbeitsplätze langfristig sichern und viele neue schaffen. Es müsste aber gute Arbeit Zeit, die angemessen bezahlt ist, gute Arbeitsbedingungen bietet und die Rechte der Beschäftigten achtet. Das ist heute zum Beispiel in der Windbranche in der Regel nicht der Fall. Wenn beides gelingt, sagte Kerner, „wird der Umbau nicht als Bedrohung gesehen, sondern als Chance“.
Zum Weiterlesen::
Präsentation Fritz Reusswig Grünes Europa [ mehr... ]
Präsentation Kathryn Harrison Nachhaltiger Industrieumbau [ mehr... ]
Präsentation Kurt Hübner Grünes Wachstum [ mehr... ]